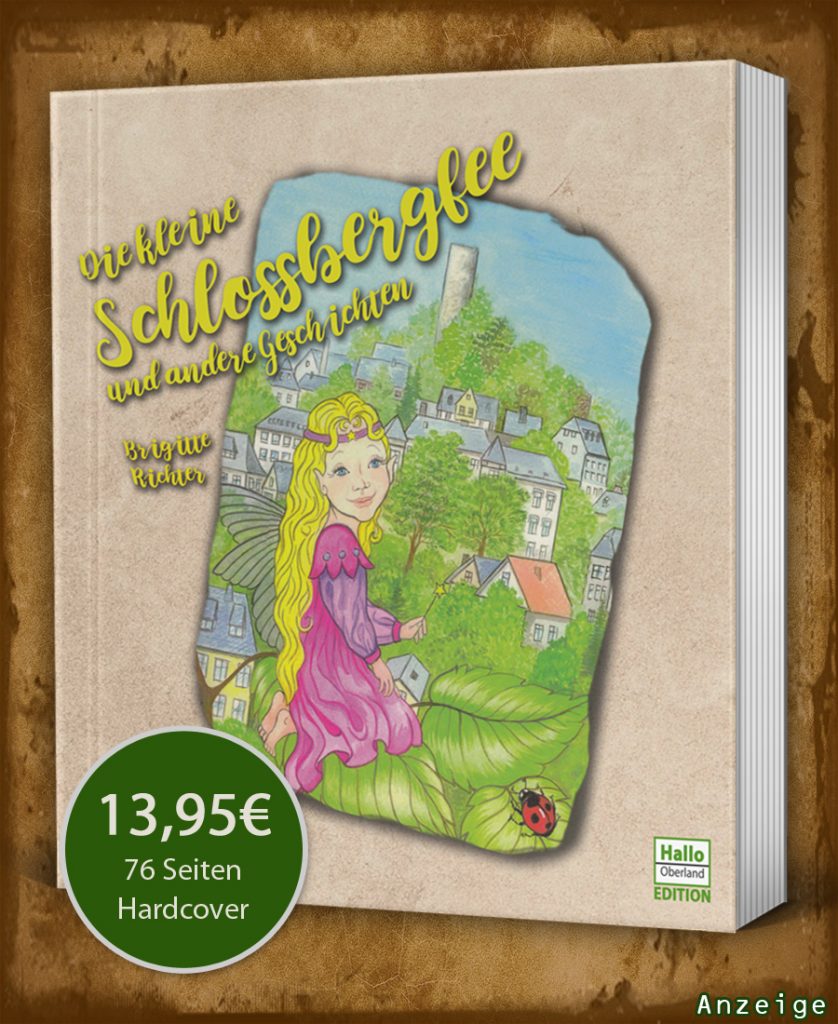von Wolfgang Kleindienst (Pößneck)
Die Veröffentlichung des Interviews wurde von der Zeitschrift „der gemeinderat“ am 10.09.25 mit folgender Begründung abgelehnt:
„Der redaktionelle Fokus im „gemeinderat“ liegt auf praxisorientierten Inhalten für die Arbeit vor Ort in den Kommunen. Unser Ziel in den redaktionellen Beiträgen ist es also nicht, für Positionen zu werben, sondern Erfahrungen weiterzugeben.
Die Antworten, die Sie uns gesendet haben, haben wir in der Redaktion besprochen. Wir sehen darin ein großes Engagement für die Sache und eine klare Haltung, was wir sehr respektieren. Allerdings haben wir uns entschieden, den Beitrag nicht zu veröffentlichen. Wie bereits erwähnt, möchten wir im Sinne der redaktionellen Ausrichtung keine politischen Meinungen darlegen, sondern den Fokus auf praxistaugliche Ansätze und übertragbare Lösungen legen.
Wir hoffen, Sie haben Verständnis für diese redaktionelle Entscheidung. Vielleicht ergibt sich zu einem späteren Zeitpunkt eine Gelegenheit für einen Beitrag mit stärkerem Praxisbezug – wir würden uns freuen, wieder von Ihnen zu hören.“
Dr. Sabine Schmidt
Redaktionsleitung „der gemeinderat“
Hier das nicht veröffentlichte Interview vom 06.09.25
Pößneck hat 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Strom zu versorgen. Wie sieht es bei Ihnen vor Ort aus: Wie hoch ist der Anteil der Erneuerbaren – wie ist Pößneck im Bereich der Strom- und Wärmeversorgung aufgestellt?
Der Anteil der Erneuerbaren Energien in Pößneck ist nicht messbar. Die Zusammensetzung der Erzeugungsarten im Verteil- und Höchstspannungsnetz sind abhängig von den jeweiligen Witterungsbedingungen der Jahres- und Tageszeiten. Laut Statistiken schwankt der Anteil im Netz zwischen 6 % und 54 %. Pößneck bezieht den Strom von den Stadtwerken Energie Jena- Pößneck, die wiederum aus dem Netzgebiet der Thüringer Energie AG. In der Öffentlichkeit werben die Stadtwerke Jena-Pößneck mit 100 % Ökostrom. Das entspricht nicht der physikalischen Wahrheit.
Betrachtet man die Thüringer Netzbetreiber ist festzustellen, dass wir eine installierte Leistung von Windkraftanlagen und PV Anlagen in Thüringen in Summe von 4.686 MW haben. Dem gegenüber steht eine Netzlast (Stromverbrauch), laut öffentlichen Netzdaten der Thüringer Energie Netze zum 23.10.24, in Thüringen von 1.212 MW. Die installierte Leistung ist bereits heute um 3.474 MW höher als die Netzlast, das sind 286 %.
Diese installierte Leistung ist also schon fast um das dreifache höher wie der Stromverbrauch in Thüringen. Eingespeister Strom aus regenerativen Energien wird immer mehr in die vorgelagerten Netze transformiert und belastet zunehmend die Netzsicherheit.
Die Kommunalpolitik muss die physikalischen Grundsätze in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen stellen. Denn es kann immer nur so viel Strom eingespeist werden, wie verbraucht wird.
Die Strom- und Wärmeversorgung in Pößneck wird durch die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck vorgehalten. Im Stromnetz wären große Investitionen notwendig, um die überzogenen politischen Vorgaben einzuhalten. Das führt zu weiteren unverantwortlichen Steigerungen der Netzentgelte und somit zu einer Belastung der Stromkunden und der Stadt Pößneck selbst. Bis 2045 könnten sich bei unveränderter Systematik die Netzentgelte verdoppeln.
Für die Wärmeversorgung muss bis Ende 2028 eine Wärmeplanung aufgestellt werden.
Wir erachten das als eine überflüssige „Planwirtschaft“ und als eine unnötige bürokratische Aufgabe. Einen Fernwärmezwang lehnen wir ab. Die Wärmeversorgung der Grundstücke muss immer in der Entscheidungsgewalt der Grundstückseigentümer bleiben.
Die Technologieoffenheit bei der Wahl des Heizungsmediums muss oberste Priorität haben damit ein unverzerrtes Entscheidungsumfeld es erlaubt, unterschiedliche Technologien zu entwickeln und die beste Technologie zur Zielerreichung frei auszuwählen.
Die Stadt Pößneck sollte sich bei ständig wechselnden Bedingungen auf dem Energiemarkt nicht allein auf die Versorgung mit Fernwärme festlegen. Anbieter in Thüringen rechnen damit, dass sich der Preis für Fernwärme in den kommenden 20 Jahren, also bis etwa 2040, verdoppeln wird, vor allem durch teure Umstellungen der Erzeugungstechnik. Der Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft warnt, dass der Wegfall der Energiepreisbremse und eine steigende Mehrwertsteuer das Preisniveau weiter stark erhöhen könnten, in Einzelfällen sei eine Verdopplung möglich. Laut einer aktuellen Studie der Prognos AG für AGFW & VKU sind 43,5 Mrd. € bis 2030 notwendig, ursprünglich war man von 32,9 Mrd. € ausgegangen. Das ist ein Mehrbedarf von 10,6 Mrd. €. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW), mit 3,5 Mrd. € bis Ende 2028, reicht bei weitem nicht aus. Das alles spricht gegen die Strategie des Ausbaus der Fernwärme.
Die politischen Rahmenbedingungen der Energieversorgung werden sich ständig ändern. Derzeit sind die Kosten für Fernwärme zu hoch und stehen nicht im Wettbewerb mit anderen Medien der Wärmeversorgung. Hinzu kommt, dass ein Wettbewerb (Lieferantenwechsel), wie in der sozialen Marktwirtschaft eigentlich üblich, nicht möglich ist. Dagegen sprechen auch die derzeit hohen und steigenden Baukosten bei der Erschließung durch Fernwärme, die zu einer weiteren Kostensteigerung führen.
Auch die Zukunft der Gasversorgung kann sich schneller wieder zum Besseren ändern. Es entsteht der Eindruck, dass abseits ökologischer und ökonomischer Fakten die Gasversorgung verteufelt werden soll, um mit z.B. Fernwärme oder Wärmepumpen einen neuen Markt zu Lasten der Verbraucher aufzubauen. Die Sinnhaftigkeit der zusätzlichen Belastung der Kosten durch CO2 Zertifikate steht dabei zunehmend unter Kritik.
Ohne eine grundlegende Reform der gescheiterten Energiewende sind kaum Spielräume für Gemeinderäte bei der selbstständigen Entscheidung der Strom- und Wärmeversorgung vor Ort möglich.
Sie sprechen sich nicht grundsätzlich gegen die Erneuerbaren aus – Ihnen geht es aber darum, wie die Stromerzeugung geplant wird, wobei Sie insbesondere Flächenverbrauch und Kosten im Blick haben. Verstehe ich Sie richtig? Was ist für Sie entscheidend?
An dieser Stelle muss ich klar stellen, dass der Begriff „Erneuerbare Energien“ schon falsch ist. Denn Wind und Sonne kann man nicht „erneuern“. Eigentlich müsste es „Regenerative Energien“ heißen. Aber bleiben wir bei dem sicherlich nicht zufällig gewählten Begriff.
Wir sprechen uns für die dezentrale Nutzung Erneuerbarer Energien aus, die den Eigenbedarf des Stromverbrauches senken. Wir sprechen uns für Anlagen auf Dach- und Fassadenflächen aus, für die Nutzung bereits versiegelter Brachflächen, z.B. auf alten Deponien, an Autobahnen oder auf landwirtschaftlichen Gebäuden etc. aus. Wir lehnen die Versiegelung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen durch Solarparks und Windkraftanlagen ab.
Nicht die Flächen sondern die installierte elektrische Leistung muss zum Maßstab werden.
Die installierte Leistung sollte nicht die durchschnittliche verbrauchte elektrische Leistung in der Tagesspitze des jeweiligen Bundeslandes übersteigen. Um das zu erreichen sind zumindest das Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land (Windenergieflächenbedarfsgesetz – WindBG), das Thüringer Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) und die Privilegierung der Errichtung von Windkraftanlagen im Außenbereich ohne eine Bebauungsplanpflicht nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB abzuschaffen bzw. zu ändern. Bis zur Abschaffung der benannten Gesetze ist ein Moratorium der Gesetzgeber zur Aufschiebung eines weiteren drohenden Ausbaus von Windkraftanlagen dahingehend zu beschließen.
Die Strompreise haben sich in den letzten 10 Jahren durch die s.g. „Energiewende“ verdoppelt. Hauptursache ist die verfehlte Energiepolitik der letzten 20 Jahre. Die BRD muss auch hier zur sozialen Marktwirtschaft zurück kehren. Grundlastfähige Erzeugungsanlagen gehören dorthin, wo die Schwerpunkte des Stromverbrauchs sind. Der ungebremste Ausbau von erneuerbaren Energien verursacht einen unnötigen Netzausbau. Dadurch steigen die jetzt schon viel zu hohen Netzentgelte weiter und belasten den Lebensunterhalt. Dadurch werden auch zunehmend die Kosten für Gemeinden ansteigen. Es ist dringend ein Paradigmenwechsel hin zu den Stromgestehungskosten notwendig. In den Stromgestehungskosten werden Investitions-, Betriebs-, und Wartungskosten ebenso wie die Finanzierungskosten der Erzeugungsanlage berücksichtigt. Stromgestehungskosten sind ein zentrales Instrument, um unterschiedliche Energieträger hinsichtlich ihrer langfristigen Wirtschaftlichkeit zu bewerten und zu vergleichen. Wir fordern die Abkehr von der staatlich zugesagten Einspeisevergütung für regenerative Energien und die Einführung der Gestehungskosten. Das wäre die Beendigung der „Grünen Planwirtschaft“ und die Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft.
Die Dunkelflaute ist eines der zentralen Probleme von Wind- und Solarenergie. Hier gilt für viele, dass Speichersysteme einen gravierenden Fortschritt bedeuten. Warum sehen Sie das anders bzw. wie sehen Sie das?
Batteriespeicher benötigen Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel, deren Abbau ökologische und soziale Probleme mit sich bringt. Großspeicher (v. a. Batteriefabriken und -lager) verursachen Flächenverbrauch und können Umweltauflagen entgegenstehen. Bei einer Dunkelflaute reicht deren Kapazität für 2-3 Stunden Vollast. Das ist nicht ausreichend und sie besitzen keine Grundlastfähigkeit.
Stromkunden bezahlen sowohl den Ausbau von Speichertechnologien als auch steigende Strompreise durch Netzentgelte und Marktmechanismen. Industriekunden sind oft teilweise befreit von Umlagen, während private Haushalte den größten Anteil zahlen. Batterien werden oft von Energieunternehmen gebaut und betrieben. Diese verdienen Geld durch Arbitrage (billigen Strom einkaufen, teuren verkaufen) und Netzdienstleistungen (Frequenzhaltung, Reservekapazität). Hier ein Beispiel: Kaufpreis nachts: 20 €/MWh; Verkaufspreis abends:
100 €/MWh; Gewinn vor Kosten: 80 €/MWh (abzüglich Wirkungsgradverluste, Gebühren).
Großspeicher handeln aktiv an der Strombörse. Einen direkten Nutzen haben vor allem die Speicherbetreiber und Netzbetreiber, indirekten Nutzen haben Stromkunden durch stabilere Preise und Netze, allerdings tragen sie dann auch Teile der Kosten.
Zwei Gründe, die für die Erneuerbaren sprechen, sind sehr gewichtig: die Unabhängigkeit von Gasexporten und die CO2-Reduktion. Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn Sie sich für die Erneuerbaren, aber für andere Kostenstrukturen einsetzen? Und wenn Sie versuchen, die Bürgerinnen und Bürger von Pößneck für die Erneuerbaren zu gewinnen?
CO₂ ist ein natürlicher Bestandteil der Atemluft (~0,04 %). Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten im Weltweiten Vergleich überdurchschnittliche Reduzierungen zu verzeichnen. Die größten Emittenten weltweit in 2023 sind China, USA und Indien.
Gasimporte haben Deutschland kurzfristig geholfen, Kohle zu ersetzen und so CO₂ zu senken.
Die Unabhängigkeit von Gasexporten aus Russland (Russland-Sanktionen) ist ein ökonomischer „Bumerang“. Die Abhängigkeit von anderen Ländern, durch z.B. LNG Gas, ist nicht nur größer sondern auch teurer geworden. Die LNG-Gasimporte haben eine deutlich höhere CO2-Entwicklung als Pipeline-Gas, da der zusätzliche Energieaufwand für Verflüssigung, Transport und Wiederverdampfung sowie Methanlecks über die gesamte Lieferkette signifikante Emissionen verursachen. Obwohl LNG als Brückentechnologie angesehen wird, kann der Ausbau von LNG die Energiewende verlangsamen und die Klimaziele gefährden, besonders wenn es aus Fracking-Gas gewonnen wird. Der Anteil von LNG an den deutschen Gasimporten ist signifikant gestiegen, was die klimaschädlichen Auswirkungen des LNG-Imports verstärkt.
Man kann diese Entwicklung den Menschen nicht mehr plausibel erklären. Die Bürger von Pößneck werde ich weiterhin motivieren, dezentrale Lösungen von netzverträglichen PV Anlagen mit Speichern zu installieren, um den eigenen Stromverbrauch zu reduzieren. Keinesfalls werde ich für Solarparks und Windkraftanlagen werben, die unsere Natur zerstören, land- und forstwirtschaftliche Flächen versiegeln, die Landschaft verschandeln, die Energiesicherheit gefährden und die Strompreise weiter in die Höhe treiben.
Als Stadtrat fühle ich mich besonders verpflichtet solche Schäden abzuwenden. Das erwarte ich auch von Bundes- und Landespolitikern.
Was ist die Alternative zur Windenergie in Pößneck – was wollen Sie erreichen?
Die Alternative zur Windenergie sind dezentrale Lösungen von netzverträglichen PV Anlagen mit Speichern. Dafür sind auch alle geeigneten kommunalen Dach- und Brachflächen heranzuziehen. In Pößneck gibt es 3173 Gebäude mit Wohnraum. Wenn jedes zweite Gebäude eine PV-Anlage mit Speicher besitzt, gäbe es jährlich eine Einsparung von ca. 3.000 Tonnen CO2. Dies allein ist eine wirksame und sinnvolle Alternative zur Windenergie und zum s.g. CO2-freien Fernwärmeausbau.
Im Wärmesektor müssen wirtschaftliche und technologieoffene Lösungen möglich sein.
Die Gasversorgung im Strom und Wärmesektor wird mittelfristig weiterhin notwendig, um auch die Netzsicherheit zu gewährleisten. Langfristig bin ich optimistisch, dass zukunftsweisende Entwicklungen der Kernenergie auch für Pößneck eingesetzt werden können. Weltweit geht der Trend zu neuen Reaktorkonzepten, darunter Small Modular Reactors (SMRs), die eine flexiblere, dezentrale und potenziell kostengünstigere Stromproduktion versprechen. SMRs können die Schwächen der erneuerbaren Energien ausgleichen und eine dezentrale, CO2-arme Stromproduktion ermöglichen. SMRs sind flexibler, sicherer und kostengünstiger in der Produktion und im Bau. Ihre Komponenten werden in Fabriken gefertigt und anschließend zum Standort transportiert.
Für Thüringen wären, neben den bestehenden drei Pumpspeicherkraftwerken, etwa drei SMRs notwendig (jeweils etwa 300 MW Leistung), um die gesamte Stromversorgung sicher und frei von CO2 zu organisieren. Dadurch werden weitere Windkraftanlagen und Solarparks überflüssig.
Freundlichen Grüße
Wolfgang Kleindienst
Mitglied des Stadtrates Pößneck